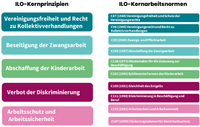Internationale Gewerkschaftspolitik
Ganz nach dem Grundsatz der ILO-Verfassung, dass der Weltfrieden auf die Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden kann, sind wir gemeinsam mit den Kollegen des IGB und der FES weltweit aktiv. Die großen Themen unserer Zeit, wie das Eintreten für demokratische und gewerkschaftliche Grundrechte, einen gerechten Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, faire Arbeitsbedingungen in der digitalen Arbeitswelt, menschenwürdige Einkommen und Arbeitsbedingungen entlang nachhaltiger Lieferketten, den Auf- und Ausbau von Sozialsystemen u. v. m. erfordern internationale Kooperation und Koordination.
In den Gremien des IGB legen wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen anderer Gewerkschaftsbünde die konkreten Schritte und Aktivitäten zum Erreichen unserer Ziele fest.
Wo auch immer uns sich die Möglichkeit bietet, stärken wir die Stimme der Beschäftigten weltweit und nehmen Einfluss auf Entscheidungen und Entscheidungsträger – sei es bei der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), anderen UN-Organisationen, im Prozess der G7 und G20 Arbeits- und Sozialministerinnen und -minister oder bei nationalen Konsultationen zu internationalen Vorhaben verschiedener Bundesministerien und -behörden.
Der DGB im EGB
Der Europäische Gewerkschaftsbund ist die Stimme der Gewerkschaften Europas gegenüber den Europäischen Institutionen.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB, englisch ETUC für European Trade Union Confederation/CES, französisch für Confédération Européenne des Syndicats) wurde 1973 gegründet. Er vertritt 93 nationale Gewerkschaftsbünde aus 41 Ländern und 10 europäische Branchenverbände mit insgesamt 45 Millionen Mitgliedern. Er koordiniert 39 interregionale Gewerkschaftsräte mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit, davon 14 mit deutscher Beteiligung.
Als Vertreter der europäischen Arbeitnehmer*innen kann sich der EGB direkt an den europäischen Gesetzgebungsverfahren beteiligen. In speziellen Fällen können der EGB oder die europäischen Branchenföderationen mit den europäischen Arbeitgeberverbänden Vereinbarungen abschließen, die Rechtsstatus erlangen können. Die Richtlinien zum Recht auf Teilzeitarbeit oder Elternurlaub haben wir so verhandelt.
In den Gremien des EGB werden gemeinsam mit den Gewerkschaftsorganisationen Europas politische Positionen erarbeitet, mit denen sich der EGB in die Debatten und laufenden Gesetzgebungsvorhaben in Brüssel einmischt.
Der Kongress ist das oberste Gremium des EGB. Er wird alle vier Jahre einberufen, zuletzt 2023 in Berlin. Der Kongress wählt die Leitung und die wichtigsten Gremien des EGB.
- Generalsekretärin ist Esther Lynch (TUC Irland)
- Exekutivkommittee – Das Exekutivkomitee ist das höchste Entscheidungsgremium des EGB zwischen den Kongressen. Das Komitee trifft sich viermal im Jahr und besteht aus den Vertretern der Mitgliedsorganisationen. Es entscheidet u.a. über Mandat und Zusammensetzung der Delegationen für den Europäischen Sozialdialog.
- Steuerungskommittee - Das Steuerungskomitee bereitet die Sitzungen des Exekutivkomitees vor und ist dafür verantwortlich, dass die Entscheidungen des Exekutivkomitees umgesetzt werden. Dieses kleinste der EGB-Gremien trifft sich acht Mal pro Jahr. Es besteht aus 21 gewählten Mitgliedern des Exekutivkomitees.
Der DGB ist Mitglied im Exekutiv- und Steuerungskomitee des EGB.
Zur Seite der ETUC – European Trade Union Confederation
Der DGB unterhält zudem ein Verbindungsbüro in Brüssel.
Der DGB im IGB
Der IGB wurde 2006 durch den Zusammenschluss des Internationalen Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) und des Weltverband der Arbeitnehmer (WVA) sowie acht bisher keinem internationalen Dachverband angeschlossener Gewerkschaften gegründet. Er vertritt 191 Millionen Beschäftigte in 340 Mitgliedsorganisationen und 169 Ländern und Hoheitsgebieten.
Neben dem Hauptsitzbüro in Brüssel besteht der IGB aus drei Regionalorganisationen: die Regionalorganisation für Asien/Pazifik (IGB-AP) in Singapore, die Regionalorganisation für Afrika (IGB-AF) in Lomé und die Regionalorganisation für Gesamtamerika (IGB-TUCA) in Montevideo. Er arbeitet eng mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund zusammen, u.a. im Rahmen des Pan-Europäischen Regionalrates.
In enger Kooperation mit den Globalen Gewerkschaftsföderationen (GUF) und dem Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss bei der OECD (TUAC). vertritt der IGB die Interessen der Beschäftigten auf globaler Ebene. Er stellt das Sekretariat der Arbeitnehmergruppe der ILO und arbeitet eng mit verschiedenen anderen Sonderorganisationen der UN zusammen.
Das oberste Gremium des IGB ist der Kongress, der regulär alle vier Jahre zusammenkommt. Der letzte außerordentliche Kongress wurde virtuell am 12. Oktober 2023 abgehalten und wählte Luc Triangle zum Generalsekretär.
Der letzte ordentliche Kongress fand vom 17. bis 22. November 2022 in Melbourne statt.
- Vorstand – Der Vorstand trifft sich zwei Mal im Jahr und entscheidet unter anderem über wesentliche politische Fragen, die Finanzen, die Aufnahme neuer Mitgliedsorganisationen.
- Lenkungsausschuss – der Lenkungsausschuss tritt ebenfalls zwei Mal im Jahr zusammen und befasst sich mit den Finanzen des IGB und seiner Regionalorganisationen.
Der DGB im G20 und G7 Prozess
Der DGB ist Teil der gewerkschaftlichen Interessenvertretung Labour 20 und Labour 7 (L20 und L7), die sich aus den nationalen Gewerkschaftsbünden der jeweiligen Ländergruppen zusammensetzen. Innerhalb dieser Gremien und in enger Kooperation mit den Arbeits- und Sozialministerien vertritt der DGB die Interessen der Beschäftigten.
Auch wenn die Abschlusserklärungen der G20 und G7 sowie die Abschlusserklärungen der Arbeits- und Sozialminister*innen keinen bindenden Charakter haben, können sie doch wichtige Signale für den internationalen, politischen Diskurs senden und Arbeitsaufträge an internationale Organisationen beinhalten.
Der DGB und Histadrut
Die Partnerschaft zwischen Histadrut, dem israelischen Gewerkschaftsbund, und dem DGB ist ein herausragendes Beispiel für gelebte internationale Solidarität und historische Verantwortung. Seit nunmehr 50 Jahren besteht diese enge Zusammenarbeit, die wir 2025 in Berlin gefeiert haben. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir das Partnerschaftsabkommen erneuert und ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus und Rassismus abgegeben. Unser gemeinsames Ziel: den großen Herausforderungen der Arbeitswelt zu begegnen – für alle Beschäftigten, unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Herkunft.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Partnerschaft liegt auf der Förderung junger Gewerkschafter*innen. Wir setzen den engen Austausch zwischen den Jugendorganisationen unserer Länder fort, um die nächste Generation von Arbeitnehmervertreter*innen zusammenzuführen. Während der Feierlichkeiten in Berlin wurden zudem israelische Kolleg*innen für ihr Engagement mit der Hans-Böckler-Medaille ausgezeichnet – der höchsten Auszeichnung der Gewerkschaften in Deutschland. Diese Würdigung unterstreicht die Bedeutung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen Werten wie sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und demokratischer Teilhabe basiert. Die Partnerschaft zwischen Histadrut und DGB zeigt eindrucksvoll, wie Gewerkschaften Brücken bauen können – über kulturelle und geografische Grenzen hinweg – und dabei einen wichtigen Beitrag zu einer gerechten und solidarischen Arbeitswelt leisten.